FlexQuartier2 – Teilvorhaben: Langzeit-Monitoring des FlexQuartiers und Vergleich mit alternativen Versorgungskonzepten
Ausgangslage
Für die Minimierung der CO2-Emissionen der Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren ist neben dem energetischen Standard der Gebäude einerseits eine regenerative Energieerzeugung erforderlich, andererseits müssen das Erzeugungsprofil fluktuierender erneuerbarer Energien mit dem Verbrauchsprofil der Gebäude in Einklang gebracht werden. Hierzu werden unterschiedliche Energiespeicher genutzt. Neben klassischen thermischen und elektrischen Energiespeichern werden auch neue Konzepte für die Speicherung elektrischer Energie entwickelt. Ein solcher Ansatz ist die Carnot-Batterie, die elektrische Energie auf hohen Temperaturen speichert und zeitversetzt rückverstromen kann. Die Abwärme kann dabei zur Wärmeversorgung der Gebäude genutzt werden.
In dem Vorgängerprojekt FlexQuartier (FKZ: 03ET1607A-E) hat die Hochschule Mittelhessen eine solche Carnot-Batterie als Hybridspeicher für Wärme und Strom entwickelt und in dem Konversionsquartier Philosophenhöhe in Gießen umgesetzt. Die Überschüsse der PV-Stromerzeugung der Neubauten des Quartiers werden in der Energiezentrale in einem Hochtemperatur-Feststoffspeicher für eine spätere Rückverstromung mit einer Gasturbine genutzt, die Abwärme wird mit Hilfe von Wärmepumpen in das Fernwärmenetz des Quartiers eingespeist. Die Energiezentrale soll nun im realen Betrieb untersucht und bilanziert werden, um Erfahrungen im Betrieb eines Hybridspeichers im Zusammenspiel mit dem Quartier zu sammeln und eine Einordnung der Effizienz im Vergleich zu anderen Versorgungslösungen vorzunehmen.
Ziele
Im Verbundvorhaben „FlexQuartier2 - Betriebsoptimierung und Monitoring eines flexiblen Hybridspeichersystems zur Sektorenkopplung und für Netzdienstleistungen im Quartier Philosophenhöhe Gießen“ wird der Hybridspeicher während des Projekts weiter betrieben, in praxisnahen Versuchen getestet und kontinuierlich optimiert. Der Verbundpartner Hochschule Mittelhessen fokussiert sich auf das effiziente Zusammenspiel der Anlagen- und Speichersysteme in der Energiezentrale, theoretische Untersuchungen und statische sowie dynamische Charakterisierungen des gesamten Systems, außerdem die Erstellung eines digitalen Zwillings des Hybridspeichers sowie Geschäfts- und Betreibermodelle und rechtliche Rahmenbedingungen.
Parallel dazu wird ein vierjähriges Monitoring durchgeführt, mit dessen Hilfe das IWU die Energieströme und Treibhausgasemissionen der Energiezentrale und des Quartiers bilanziert. Basierend auf den Messdaten werden Vorschläge zur Betriebsoptimierung der Anlagentechnik und des Quartiers entwickelt. Der Hybridspeicher wird im Vergleich zur dezentralen Nutzung von Wärme- und Stromspeichern bewertet und das Gesamtkonzept des Quartiers wird im Vergleich zu anderen zentralen sowie dezentralen Energieversorgungskonzepten eingeordnet. Schließlich werden die energetischen Standards der Gebäude des FlexQuartiers variiert, um die Auswirkungen auf die Bewertung des Konzepts zu untersuchen und Erkenntnisse für die Übertragbarkeit auf andere Quartiere und energetische Gebäudestandards zu gewinnen.
Vorgehen
Das Teilvorhaben des IWU umfasst sieben Arbeitspakete (AP):
- In AP1 werden sowohl das gesamte Quartier als auch die Energiezentrale mindestens 2 Jahre lang mit Hilfe eines energetischen Monitorings vermessen und bewertet. Im Fokus stehen die im Quartier erzeugten und verbrauchten Energien (Wärme und Strom) im zeitlichen Verlauf, der Anteil der Energieerzeugung im Quartier am Gesamtbedarf, die Gesamtbilanzen und die Treibhausgasemissionen.
- In AP2 wird das Betriebsverhalten des Hybridspeichers mit Hilfe von Lastgängen aus Sicht des Quartiers analysiert und es werden Vorschläge für eine Betriebsoptimierung erarbeitet.
- AP3 bilanziert die dezentrale PV-Stromerzeugung im Quartier, die PV-Überschüsse und den Einfluss auf die Nutzung im Hybridspeicher.
- AP4 schließt mit einem Vergleich zwischen zentralen (Hybridspeicher) und dezentralen (Wärmepumpe, Heizstab, Elektrospeicher) Konzepten zur Nutzung von PV-Überschüssen an und vergleicht die verschiedenen Konzepte in einem Modell bezüglich der Gesamteffizienz auf Quartiersebene.
- In AP5 wird das umgesetzte Wärme- und Stromversorgungskonzept für die Philosophenhöhe weiteren, für das Quartier denkbaren dezentralen Versorgungskonzepten, gegenübergestellt. Daneben erfolgt ein Vergleich mit Messdaten aus anderen Quartieren. Ziel des Arbeitspaketes ist das Erarbeiten eines Leitfadens für Entscheidungsträger für Planungen im Quartierskontext, der Chancen und Risiken verschiedener Konzepte beleuchtet.
- Der Einfluss des energetischen Standards der Gebäude auf die Effizienz der Wärmeversorgung wird in AP6 untersucht und u.a. bezüglich der Netzverluste und der Netztemperaturen des Fernwärmenetzes untersucht.
- In AP7 werden die Ergebnisse des Teilprojektes dokumentiert und die Übertragbarkeit auf andere Quartiere, Randbedingungen und Gebäude untersucht.
Bearbeitungszeitraum und Ergebnisse
Dezember 2023 - November 2027
Projektteam IWU
Kontakt
![]() Marc Großklos
Marc Großklos![]() 06151 2904-47
06151 2904-47![]() m.grossklos(at)iwu(dot)de
m.grossklos(at)iwu(dot)de
Fördermittelgeber
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (FKZ: 03EN3091B)
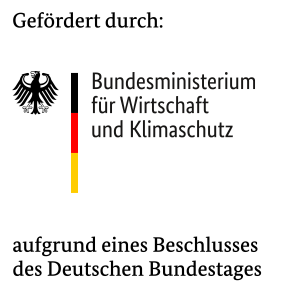
Partner
- Technische Hochschule Mittelhessen
- Stadtwerke Gießen